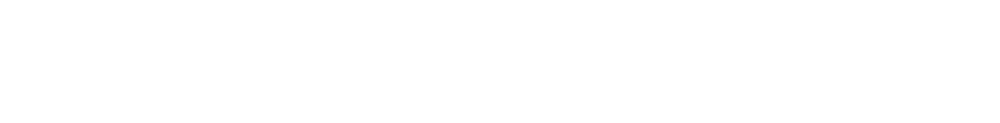Mein Denken und Handeln
Mein Zugang zum Leben als Helfer, Berater, Sparringspartner, Therapeut
Wie alles anfing
Als junger Mann saß ich, weiß bekittelt, in der Psychiatrie einer Universitätsklinik einem gestandenen Mann(sbild) gegenüber, der von Angstzuständen und Panikattacken berichtete. Ich arbeitete mein diagnostisches Werkzeug ab, ging emphatisch auf mein Gegenüber ein und isolierte einige Treiber seines Befindens. Mein Supervisor und Lehrtherapeut war mit mir zufrieden – während ich selbst, je länger der Prozess lief, ein substantielles Unbehagen verspürte – war mir doch die Lebenswelt meines Klienten, der Vorarbeiter in einem Produktionsbetrieb war, ziemlich fremd. Diese Einschätzung, nur abstrakt und auf der Begriffsebene mehr oder minder anschlussfähig zu sein und nicht wirklich ein Leben zu verstehen, ließ in mir den Entschluss reifen, der durchaus geliebten Psychotherapie Valet zu sagen und das „wahre“ Leben und seine Alltagserfahrungen kennen zu lernen (heute wüsste ich, dass ein damals noch nicht so genanntes Mobbing am Arbeitsplatz wohl ursächlich Grund für die klinischen Befunde meines Patienten war).
Figur und Grund
Während meiner folgenden Berufsjahre und -jahrzehnte war ich der klinischen Psychologie und Psychotherapie immer verbunden, habe mich kontinuierlich weitergebildet und gezielt und regelmäßig therapeutisch gearbeitet. Das Arbeiten in Unternehmen als Führungskraft und das Wirken als Berater in unterschiedlichen Organisationen kann und sollte man (auch) mit einem psychologischen Blickwinkel begleiten, wie ich es in der 1995-er Monographie zur „Praxis der Veränderung in Organisationen“ dargelegt habe. In der Figur/Grund Metapher der Gestaltpsychologie ist der „Grund“, die Folie oder die Rahmenbedingung das psychologische Geschehen, vor und auf dem sich die Figur des konkreten Tuns, der aktuellen Situation abspielt (und bei der das Vergangene zum „Grund“ gehört), alle denkbaren Formen von Störungen inbegriffen. Deswegen ist es bei jeder Diagnose so wichtig, den Lebenslauf abzubilden, in den sich eine Problemlage hineingearbeitet hat.
Therapeutisches Rüstzeug
Meine methodischen und therapeutischen Wurzeln sind stark kognitionspsychologisch:
- Wie Menschen Probleme lösen (oder auch nicht), habe ich vor allem von Dietrich Dörner gelernt; nachzulesen unter Chancen des Scheiterns.
- Der stärkste therapeutische Impuls kommt von Albert Ellis und seiner rational-emotiven Therapie mit ihren plastischen und drastischen Handreichungen und Bildern für den Umgang mit irrationalen Überzeugungen („Deine Gedanken machen Dich krank“).
- Niklas Luhmann, Kurt Ludewig und die Heidelberger Schule stehen für die systemtheoretische Perspektive und die Rolle des (diagnostizierenden) Beobachters in meiner Ausrichtung des pragmatischen Eklektizismus:
- jede Idee, Konzeption oder Theorie aus dem psychologischen und therapeutischen Universum, die meiner Neugier begegnet und Interesse weckt, wird auf ihre Anwendbarkeit gedacht und (behutsam) ausprobiert.
- Meine Berufs- und Lebenserfahrung ist wesentliche Ressource für meine Arbeit.